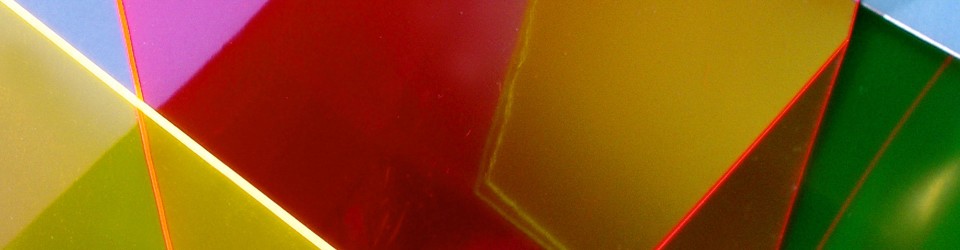90 Jahre Plexiglas: von Brillengläsern, Fensterscheiben und Musikinstrumenten
Die Entdeckung des Plexiglases war reiner Zufall. Chemiker Otto Röhm war auf der Suche nach einem künstlichen Kautschuk, als er das Polymethylmethacrylat entdeckte. Unter dem Markennamen Plexiglas trat der Kunststoff seit den 1920er Jahren einen Siegeszug an, der bei Brillengläsern begann und bei Folien für das Münchner Olympiastadion noch lange nicht endet.
27.11.2019, Laila Haidar
„Das erste organische Glas“ nennt Otto Röhm seine Erfindung, als er sie 1933 zum Patent anmeldet. Groß heraus kommt das Acrylglas dann bei der Berliner Ausstellung Deutschland 1936, wo unter anderem die Fensterscheibe für einen Zeppelin, wie auch Musikinstrumente aus Plexiglas gezeigt werden. Ein Jahr später, 1937 auf der Weltausstellung in Paris, erhält der neuartige Kunststoff den Großen Preis und eine Goldmedaille. Bis heute ist Plexiglas ein für Unternehmen interessantes Traditionsprodukt, das unter anderem in den Fensterscheiben von Flugzeugen zum Einsatz kommt. Erst im vergangenen Jahr wurde die Plexiglas-Fertigung vom Hersteller Evonik an den Finanzinvestor Advent verkauft. Betroffen sind 1100 Mitarbeiter im Rhein-Main-Gebiet. Davon 450 in Darmstadt, wo Plexiglas-Rohmasse und -platten hergestellt werden, und 500 in Weiterstadt. Sie produzieren Folien aus Plexiglas, wie sie aus dem 1972 gebauten Olympiastadion in München bekannt sind. Dazu kommen 180 Stellen in der Verwaltung in Hanau. Doch der Investor übernimmt nicht nur die Fertigung, sondern auch die Mitarbeiter und Anlagen. Bis Ende Juni 2023 ist ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vereinbart. Außerdem wolle Advent kräftig investieren – etwas, das Evonik in den vergangenen zwei Jahren nur noch wenig getan hat.
Zufallsprodukt: durchsichtige Kautschukalternative
Dass seine Entwicklung einmal zum Gegenstand harter Verhandlungen werden würde, konnte Chemiker Otto Röhm freilich nicht wissen, als er Anfang des 20. Jahrhunderts auf die revolutionäre Alternative zu Glas stieß. Als er mit Acrylsäure experimentierte, wollte er eigentlich ein Material erschaffen, das ein Ersatz für den damals sehr begehrten Naturkautschuk bieten und die Wirtschaft weniger abhängig vom südamerikanischen Gummibaum machen sollte. Rasch entdeckte er, dass beim Verestern, also in organischen Verbindungen mit der Acrylsäure, ein durchsichtiger Gummi entstand. Er fand heraus, dass sich der hier gewonnene Kunststoff verfestigte und sich durchsichtig wie Glas aber verhältnismäßig biegsam verhielt.
In den darauffolgenden Jahren ergaben sich weitere Fortschritte in der „Gummiarbeit“, wie Röhm seine Forschungen nannte. Wirtschaftlich bedeutsam für die Firma Röhm & Haas wurde das Methylacrylat als Lösungsmittel zwischen den einzelnen Schichten von Sicherheitsglas. Später wurden ähnliche chemische Verbindungen in der Textilindustrie eingesetzt, um Regenmäntel und wasserfeste Kleidung sowie Planen herzustellen. Im Jahr 1933 konnte Röhm seine Erfindung unter dem Namen Plexiglas, als Warenzeichen anmelden. Eine erste Produktion lief im Werk Darmstadt an. Ein Jahr später waren es bereits 20 Tonnen, die von den neuen Acrylpolymeren bei Röhm & Haas fabriziert wurden.
Im Alltag kaum mehr wegzudenken
Gegenüber Glas weist Plexiglas verschiedene positive Eigenschaften auf, die das Material für den Einsatz in Industrie und Alltag interessant machen. Meist ist Acrylglas leichter als klassisches Glas und splittert weniger, wenn es zerstört wird. Daher ist es auch für den Anwender sicherer. Insgesamt ist das „organische Glas“ auch bruchsicherer und hält Wind und Wetter sehr gut aus. Plexiglas kann außerdem bei Wärme unter 100 Grad sehr gut verformt werden. Es lässt sich außerdem sägen und kleben. Das sind Gründe, warum Hersteller der verschiedensten Produkte gerne darauf zurückgreifen. Insgesamt wird durch diese Eigenschaften der Verarbeitungsprozess einfacher und günstiger, was auch die Rüstungsindustrie im zweiten Weltkrieg erkannte. Acrylglas wurde damals unter anderem für Kanzeln von Jagdflugzeugen verwendet. Heute bestehen Wintergärten aus dem durchsichtigen Kunststoff, Überdachungen von Einkaufspassagen und Bahnhofshallen, Leuchtreklamen, Lampen, Treppenstufen und so mancher Outdoor-Sessel. Auch im Haushalt findet man das Material in Form von Tortenhauben oder Salatbesteck. Der Erfinder selbst setzte auf besonders leichte und bruchsichere Brillengläser – heute ist das beim Optiker Standard. Und er ließ Musikinstrumente aus Plexiglas bauen. 1935 gab er eine Geige in Auftrag. Weitere Streichinstrumente und auch Blasinstrumente folgten.
Noch während Lebzeiten Röhms zeigte sich jedoch, dass die aus Acrylglas gefertigten Instrumente wegen ihres schlechten Klanges völlig ungeeignet waren. Plexiglas schwingt nicht so wie Holz und kann die Töne daher schlecht in Form von Schall ans Ohr des Hörers tragen. Doch sowohl im Dachgarten des eleganten Berliner Hotels Eden, als auch in den Werkshallen von Röhm & Haas spielten in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg Musikgruppen auf Instrumenten aus dem Kunststoff. Wann immer Röhm in der deutschen Metropole zu tun hatte, lauschte er den Klängen dieser Combo. Vielleicht erinnerte er sich bei dieser Gelegenheit daran, dass einmal Gummi werden sollte, was ihm später als „organisches Glas“ Erfolg brachte. Trotz der offensichtlichen Nachteile wollte auch Udo Jürgens in den 1980er Jahren nicht auf ein Klavier aus Plexiglas verzichten.
Im Dachgarten des eleganten Berliner Hotels Eden, als auch in den Werkshallen von Röhm & Haas spielten in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg Musikgruppen auf Instrumenten aus Plexiglas. Wann immer Röhm in der deutschen Metropole zu tun hatte, lauschte er den Klängen dieser Combo.
Der österreichische Komponist und Sänger Udo Jürgens bei seinem Auftritt in der Fernsehsendung "Ein Kessel Buntes" im Berliner Friedrichstadtpalast am 22.12.1991. +++(c) dpa - Report+++
Multitalent: Musikalisch begabter Chemiker und Jäger
Musikalisch begabt war auch Röhm selbst, der am Klang von Plexiglas-Instrumenten bekanntlich nichts auszusetzen hatte. Wenn er sich nicht gerade der Acrylsäure zuwandte, griff er zu Mandoline oder Klavier, ging auf die Jagd oder entspannte sich in der Natur. Ursprünglich hatte Erfinder Röhm den Beruf des Apothekers gelernt, ein anschließendes Chemiestudium schließt er im Jahr 1900 mit Examen ab. Es folgt eine Assistenztätigkeit an der Universität Tübingen mit Dissertation über die Polymerisationsprodukte der Acrylsäure. Obwohl mit diesem Wissen ausgestattet, ist er schon 60 Jahre alt, als sein Produkt zum Erfolg wird. Der Markenname „Plexiglas“ entstand, so trug sein Biograph zusammen, als Röhm voller Verblüffung auf das Ergebnis erster Versuche traf: „Jetzt bin ich aber perplex“, soll er damals gesagt und den Ausruf dann rasch in einen Markennamen umgewandelt haben.
Der Artikel erschien ursprünglich 2019 in der perspectives #6, Themen-Special: Aubruch
Bildquelle Stage: I love Photo and Apple./Moment/Getty Images